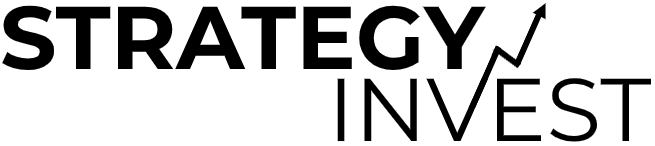Peter Thiel ist Milliardär und einer der bekanntesten Investoren unserer Zeit. Er hat PayPal mit aufgebaut, als einer der ersten in Facebook und auch in Palantir investiert.
Er hat das Buch "Zero to One" geschrieben. Ein Buch, das die zentralen Thesen aus seinen Vorlesungen an Universitäten zusammenfasst und in erster Linie ein Ratgeber für Startups sein soll, um die Welt zu verändern. Es gibt aber auch spannende Einblicke, wie er als Investor auf Unternehmen schaut.
Ich habe das Buch gelesen und möchte dir hier einmal die drei aus meiner Sicht wichtigsten Gedanken aus dem Buch mit auf den Weg geben. Es geht darum, warum Unternehmen bewusst lügen, warum Monopole gut sind, wie perfekter Wettbewerb Geschäftsmodelle zerstört und mit welchen 4 Kriterien du die stärksten Geschäftsmodelle findest. Viel Spaß!
More...
#1 Monopole sind die besten Unternehmen
Es gibt Unternehmen und Geschäftsmodelle, die zwar groß, aber schlecht sind. Es sind Geschäftsmodelle, die in perfektem Wettbewerb stehen. Ein Beispiel: Die Luftfahrt-Unternehmen, also Airlines wie Lufthansa. Sie liefern eine quasi identische Leistung, indem sie Personen von A nach B befördern. Es gibt nur winzige Unterschiede im Produkt. Der perfekte Wettbewerb führt dazu, dass Margen auf ein Minimum schmelzen.
Der perfekte Wettbewerb gilt in der VWL als Idealzustand: Unternehmen konkurrieren, die Preise sinken und die Kunden bekommen die bestmöglichen Preise.
Aus Unternehmenssicht ist das kein guter Zustand. Unternehmen streben nach einer Monopolstellung. Ein Beispiel für ein Monopol ist Google: Es gibt keine nennenswerte Konkurrenz. Google verschafft sich eine Marktmacht, kann Preise bestimmen und hat hohe Gewinnmargen.
Auch gesellschaftlich hält Thiel das Vermeiden von Monopolen für schädlich: Es kann passieren, dass die Sorge eintritt, nach der Monopole ihre Macht ausnutzen und Erlöse maximieren. Aber es gibt keine Monopole in der Geschichte, die sich dauerhaft gehalten haben, da durch Innovation und Erfindungen immer wieder neue Dynamik in der Wirtschaft entstehen. Diese gibt es dabei nur, weil es für Unternehmen die Aussicht darauf gibt, im Erfolgsfall für viele Jahre eine monopolartige Stellung zu erreichen.
Also: Unternehmen im perfekten Wettbewerb sind undifferenziert, haben geringe Gewinnmargen und ersetzbar. Monopole können Preise bestimmen, erzielen hohe Margen und nur schwer oder nicht ersetzbar.
#2 Die Monopol-Lüge der Unternehmen
Wie viele Unternehmen sind nun Monopole, wie viele stehen in perfektem Wettbewerb?
Aber: Nicht alle tun das. Peter Thiel sagt, dass beide Seiten hier lügen, wenn es darum geht, ob sie in perfektem Wettbewerb stehen oder ein Monopol sind.
Die Monopolisten reden sich klein, da sie regulatorische Eingriffe fürchten. Gerade aktuell wird in den USA bei den FAANGM-Aktien stärker darüber diskutiert als je zuvor.
Kein Monopolist gibt zu, ein Monopolist zu sein. Sie weisen daraufhin, wie klein sie eigentlich sind, indem bspw. eine andere Marktgröße als Referenz genutzt wird.
Im Google-Beispiel: Google ist Monopolist im Markt "Suchmaschinen". Google kann den Markt aber auch als digitalen Werbemarkt definieren oder den kompletten Wettbewerb (online und offline), in welchem Google nur noch einen ganz kleinen Prozentteil ausmacht.

Echte Monopolisten werden ihre Stellung so immer kleinreden.
Auf der anderen Seite reden sich Unternehmen in perfektem Wettbewerb so groß wie möglich. Sie definieren ihren Markt kleiner, um in diesem möglichst groß auszusehen.
Keines der Unternehmen würde außerdem zugeben, eine Leistung anzubieten, die komplett austauschbar ist, da sie 10 Konkurrenten genau so gut anbieten. In der Praxis gibt es aber solche Unternehmen.
Die Unternehmen, die in perfektem Wettbewerb stehen, möchten sich also so groß machen wie möglich. Sie möchten wahrgenommen werden, als seien sie auf dem Weg zu einem Monopol.
Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, bei denen es stimmt oder die Vision eintritt. Die Kunst ist es, hier als Aktionär kritisch zu hinterfragen, ob die Versprechen und Ziele wirklich realistisch sind.
Peter Thiels Schlussfolgerung daraus: Es sieht so aus, als seien die meisten Unternehmen auf einer Skala von "perfektem Wettbewerb" zu "Monopol" recht dicht zusammen, da Monopole sich kleiner und perfekte Wettbewerber sich größer machen.

In der Realität sind diese aber viel weiter auseinander als die meisten glauben:

#3 Die 4 Kriterien, die starke Geschäftsmodelle auszeichnen
Welche Kriterien kennzeichnen nun die Unternehmen, die tatsächlich Monopole sind oder die das Potenzial zu einem solchen haben?
Sie sind erstaunlich dicht an den Kriterien dran, die ich auch in der Scorecard nutze. Wenn du die letzten Aktienanalysen gelesen hast, wirst du auch diese Kriterien dort leicht ergänzt wiederfinden.
#1 Proprietäre Technologie
Eine Technologie, die das Unternehmen selbst besitzt und besonders macht, ist ein großer Burggraben. Es macht das Produkt nicht einfach kopierbar.
Thiels Faustformel: Die Lösung sollte 10x besser sein als die nächstbeste Alternative.
Dieser Faktor 10 ist nicht immer quantifizierbar, steht hier aber synonym für einen signifikanten Unterschied.
Technologien, die 10x besser sind als ihre Konkurrenten:
- Googles Suchalgorithmus
- PayPals Zahlungsfunktion, als sie Anfang der 2000er in eBay integriert wurde
- Amazons Marktstart mit einem über 10-fach größeren Buchbestand als die stationären Konkurrenten, da Amazon die Bücher nicht lagern musste
- Apples iPhone bei Einführung gegenüber anderen Handys oder das iPad gegenüber anderen Tablets
Die richtige Frage, um sich diesem Kriterium zu nähern (auch bei Nicht-Technologieunternehmen):
Haben die Produkte des Unternehmens eine Geheimzutat, die sich nicht einfach kopieren lässt und die Produkte deutlich von anderen abhebt?
#2 Netzwerkeffekte
Netzwerkeffekte entstehen dann, wenn ein Produkt besser wird, wenn andere es auch nutzen. Die zentrale Frage lautet also:
Wird das Produkt für einen Nutzer besser, je mehr andere Menschen es nutzen?
Normalerweise wird es immer schwerer ein Produkt zu verkaufen. Wer Laptops verkauft, wird diese erst an große Unternehmen verkaufen, dann an kleine, dann an einzelne Selbständige, dann an private Nutzer etc. Man startet mit der relevantesten Zielgruppe und weitet diese danach aus.
Produkte mit Netzwerkeffekten hingegen lassen sich immer einfacher anbieten, da sie mit wachsendem Netzwerk umso wertvoller und begehrter werden. Wenn auf Facebook nur fünf deiner 100 Bekannten sind, wird es dich nicht reizen. Wenn 90 von 100 dort sind, wirst du viel eher auch dort sein wollen. Das sind Netzwerkeffekte.
Beispiele dafür:
- Soziale Netzwerke und Messaging-Dienste, bspw. WhatsApp und Facebook: Je mehr Nutzer du erreichen kannst, desto wertvoller wird das Produkt
- Googles Suchmaschine: Je mehr Nutzer, desto mehr Suchanfragen und desto mehr Nutzerdaten, die die Suchergebnisse automatisieren
- Empfehlungsalgorithmen wie bei Netflix und Amazon: Je mehr Nutzer, desto bessere Empfehlungen bekommst du
#3 Skaleneffekte
Skaleneffekte (auch "Economies of Scale") sind ein Faktor, der sich auch in vielen traditionellen Industrieunternehmen wiederfindet. Dahinter steckt die Frage:
Wird das Unternehmen besser, je größer es wird?
In einigen Fällen haben es Unternehmen schwerer, u.a. durch den oben bei den Netzwerkeffekten beschriebenen Verkaufsprozess, der bei wachsender Größe zu immer schwerer zu akquirierenden Kunden führt. Auch Service-Unternehmen, deren Umsätze 1:1 die Kosten steigen lassen (bspw. in der Beratung oder Agenturen), haben kaum Skaleneffekte.
In anderen Fällen erlangen Unternehmen durch Wachstum aber entscheidende Vorteile - vor allem dann, wenn ihre Erlöse stärker steigen als die Kosten.

Beispiele dafür:
- Kostenvorteile im Produkteinkauf, bspw. im Automobilbereich oder bei Supermärkten: Je größer die Mengen, desto größer die Verhandlungsmacht bei Preisen.
- Digitale Geschäftsmodelle, die keine variablen Kosten haben (oft bei Software-Unternehmen): Mit wachsender Nutzerzahl steigt der Umsatz 1:1, die Kosten sind aber vor allem Fixkosten durch die Entwicklung, wodurch der Kostenblock kaum steigt. Die anteiligen Kosten pro Nutzer sinken, wodurch der größte Anbieter oft am günstigsten oder mit den höchsten Margen anbieten kann.
#4 Branding
Branding steht für die Marke eines Unternehmens. Die dahinterstehende Frage:
Wird das Unternehmen als starke Marke wahrgenommen?
Je stärker die Marke, desto weniger muss sich ein Unternehmen einem perfekten Wettbewerb stellen und wird alleinstehend wahrgenommen. Damit einhergehend haben starke Marken oft mehr Spielraum in ihren Preisen.
Einige können sogar durch ihre starke Marke Marketingkosten einsparen, da sie als erster Anlaufpunkt für ihr Produktsegment dienen und sich nicht durch Werbung die Aufmerksamkeit erkaufen müssen. Einige Unternehmen mit starker Marke erkaufen sich diese auf der anderen Seite auch durch höhere Marketingausgaben im Branding-Bereich.
Beispiele für starke Marken:
- Apple für Smartphones, Tablets und Computer
- Tesla für Elektroautos (wodurch es quasi keine Werbeausgaben braucht)
- Airbnb für Ferienunterkünfte
- Etsy für Selbstgemachtes
Aber: Laut Thiel sollte erst die Substanz stimmen, dann die Marke. Umgekehrt wird es gefährlich.
Fazit: Investoren sollten Monopole suchen!
Peter Thiel führt in seinem Buch viele Thesen aus. Aus Sicht eines Aktionärs lässt sich festhalten:
- Monopole sind besser als ihr Ruf
- Unternehmen in perfektem Wettbewerb haben schwierige Geschäftsmodelle
- Monopole gehen vorüber, sind aber der Idealzustand für Unternehmen
- Monopolisten reden sich klein, Unternehmen in hohem Wettbewerb reden sich groß
- Die wichtigsten Kriterien für starke Geschäftsmodelle: Proprietäre Technologie, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte & Branding